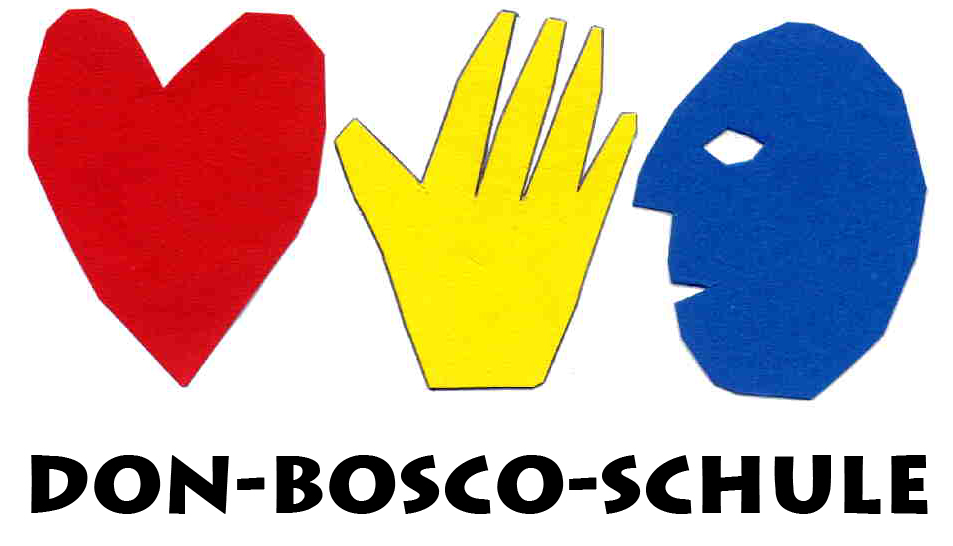Christian Dirb: Herr Haas-von der Weiden, Herr Vogt schön, dass Sie sich zu dem Interview im Rahmen des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 05. Mai bereit erklärt haben. Thematisch geht es rund um den Eintritt in den 1. Arbeitsmarkt, also von der Schule über Praktika bis hin zum Ausbildungsplatz.
Wie ist Ihre Schule organisiert, d. h. wie viele Schüler*Innen haben Sie und welche Herausforderungen haben Sie zu meistern?
Julian Haas-von der Weiden: Wir sind eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt ganzzeitliche Entwicklung. Unsere Schule besuchen etwa 80 Schüler*Innen, diese werden von 30 Lehrer*Innen unterrichtet. Unsere Klassenstufen reichen von der 1. bis zur 12. Klasse, im Alter von 6 Jahren bis 18 Jahren. Das hängt damit zusammen, dass wir von der Klassenstufe 10 bis 12 auch die Berufsschule in Form einer Werksstufe zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt im Haus haben. Wir sind eine echte Ganztagsschule. Die Schüler*Innen verbringen bei uns sehr viel Zeit.
CD: Welche Herausforderungen ergeben sich dadurch für Sie und Ihr Team?
JH-vdW: Unsere Schülerschaft ist sehr heterogen und wir fragen von Beginn, was kann / soll der Schüler*In erlernen? Wie soll die Begleitung sein, um später ein möglichst selbstständiges Leben in größtmöglicher Teilhabe in allen Bereichen führen zu können? Wie können wir unsere Schüler*Innen darauf vorbereiten? Das wird in individuellen Förderplänen festgehalten, nach denen gearbeitet wird. Ich erkläre immer: Alle Schulen haben einen Lehrplan. Auch wir haben einen Lehrplan, der ist aber sehr umfangreich. Haben wir eine Idee, die für den jeweiligen Schüler*In hilfreich sein kann, dass er das lernt, dann setzen wir das in der Regel um. Hier ist der umfangreiche Lehrplan sehr von Vorteil, da er uns eine große Freiheit bietet. Also, wenn ein Schüler ein Mobilitätstraining erhalten soll, damit er selbstständig mit dem Bus fahren kann, dann können wir das selbstverständlich unterrichten. Oder andere Bereiche wie Lesen, Schreiben und Rechnen als Teil der wichtigen Kultur-Techniken, also Lesen und Schreiben z. B. im Bereich der Kommunikation und Rechnen auch im Bereich der Welterschließung. Da erkennt man den Blick auf dieses Ganzheitliche, dass derjenige einfach glücklich und zufrieden leben können soll und dafür lesen und schreiben soll, nicht nur für die Berufswelt, sondern auch einfach die Fernsehzeitung oder den Busfahrplan lesen kann usw.
Andre Vogt: Das ist ganz individuell von Schüler zu Schüler verschieden, wenn ich das gerade noch anfügen darf. Die Schüler durchlaufen die Klassen entsprechend ihres Alters, damit sie neben Sozialem, Emotionalen mit Gleichaltrigen zusammen sind, aber sie werden sehr unterschiedlich gefördert.
CD: Also das heißt, bei all den ganzen Vorgaben in Form des Lehrplans haben Sie noch ausreichend Möglichkeiten, auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler*Innen einzugehen?
JH-vdW: Genau, das ist die Stärke der Schule.
CD: Nun haben Sie ja eben das Beispiel genannt „Mobilitätstraining“. Wie kann man sich das vorstellen?
JH-vdW: Mobilitätstraining, das ist nochmal so ein spezieller Punkt, der eigentlich alle Klassen durchzieht. Wir beginnen mit dem Fußgänger-Training, sind viel unterwegs. Wir arbeiten mit der Verkehrspolizei zusammen für die Radfahrausbildung, für Sicherheit im Verkehr und zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Wir fassen den Bereich aber noch weiter. Wir versuchen überhaupt möglichst viel unterwegs zu sein, raus in die Welt zu gehen und so Lernmöglichkeiten zu bieten, z. B. durch Ausflüge.
CD: Mobilität ist ja auch eine Voraussetzung, um irgendwo hinzukommen also auch zur Praktika-, Ausbildungs- oder Arbeitsstelle. Wie verhält es sich denn mit Praktika? Ist es leicht, eine Praktikumsstelle zu bekommen oder stellt es die Schüler*Innen vor eine Herausforderung?
JH-vdW: Das ist sehr unterschiedlich. Wir als Schule organisieren auch Praktika, u. a. organisieren wir auch immer noch geschlossene Praktika im Klassenverband in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, einfach aus verschiedenen Gründen:
- Sie bieten die Möglichkeit, sehr viel zu erproben, weil das ja dann sehr viele Einzelwerkstätten in einer großen sind.
- Sind es langjährige Partner, sodass wir da sehr gute Rückmeldung bekommen und auch diese Rückmeldung einschätzen können.
Praktikastellen auf dem 1. Arbeitsmarkt zu bekommen funktioniert häufig über Mund-zu-Mund-Propaganda, mit Hilfe der Familien, ein Nachbar, der vielleicht eine Firma hat. Das geht oft nur über persönliche Kontakte und Netzwerke. So haben wir uns nach und nach ein Netzwerk aufgebaut. Wenn wir z. B. Praktika auf dem 1. Arbeitsmarkt haben, dann ist es oft so, dass der Schüler zurückkommt und sagt: „Mensch, die haben gesagt, ich hätte gleich bleiben können“. Dann reden wir mit dem Chef und der sagt „das ging gar nicht“ oder „das war schwierig“. Auf Rückfrage, weshalb man sich anders dem Schüler*In geäußert hat, bekommen wir in der Regel als Antwort: „Wir wollten ihm ja nicht weh tun oder ihn verletzen“.
Ein Problem, was ich immer wieder von Kollegen höre im ländlichen Rheinland-Pfalz, ist in der Tat, an die Praktikumsstelle zu kommen. Dieser Punkt Mobilität ist oftmals eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung das zu organisieren, aber meistens klappt das auch, da einen Weg zu finden.
CD: Was halten Sie denn für sinnvoller? Auf dem 1. Arbeitsmarkt ein Praktikum zu machen, auch mit dem Appel der Person gegenüber ehrlich zu sein und nicht zu sagen „Du hättest gleich dableiben können“ oder „Wir würden Dich gern behalten“, denn das erweckt eineErwartungshoffnung oder erst in einem geschützten Bereich in einer Behindertenwerkstatt?
JH-vdW: Das ist eigentlich von der Reihenfolge egal. Wir haben jetzt selten Praktika, auch wenn wir sie intensiv begleiten, bei denen wir sagen „das hat nichts gebracht“ oder war negativ. Praktika haben immer einen großen Erfahrungswert für unsere Schüler*Innen, sie sind alle wertvoll. Es geht auch gar nicht so sehr darum, ein mögliches Berufsfeld zu erkunden. Das kann natürlich dabei rauskommen. Denn selbst, wenn es ein Berufsfeld ist, indem der Schüler auf keinen Fall arbeiten möchte, lernt er natürlich sehr viel und macht sehr vielfältige Erfahrungen, die man einfach nutzen kann, z. B. Kundenkontakt. Da sieht man einfach schon, ob einem das liegt oder nicht. Natürlich geht es auch um die Kernkompetenzen, die wir immer zu vermitteln versuchen, wie Durchhaltevermögen, den ganzen Tag zu stehen oder in einer gewissen Haltung, ordentlich und korrekt zu arbeiten, sich selbst einzuschätzen, im Team zu arbeiten, mit anderen zu arbeiten, Hilfe einzufordern oder mit Arbeitsmaterialien, mit Rohstoffen schonend umzugehen, weil die einem ja Geld kosten. Das alles üben wir in der Schule im Vorfeld intensiv und es ist wichtig, das im Praktikum zu erleben. Das sind neue Felder und vor allem aus Schülersicht Ansprechpersonen – ich sage immer – „aus der richtigen Welt“. Wir sind ja nur die Schule. Die kennen sie von Anfang an. Von der 1. Klasse sind Lehrer*Innen für sie da. Ich glaube, was die Erfahrungen in einem Praktikum angehen, unterscheiden sich unsere Schüler nicht so sehr von einem Gymnasiasten. Denn Erfahrungen zu machen aus der richtigen Welt, Begegnungen mit Menschen und dann gelobt zu werden, dann kommt das ganz anders an, als wenn wir Lehrer, die sie eventuell gewohnt sind seit der 1. Klasse, loben.
CD: Mit Blick auf den 05. Mai als Europäischer Protesttag zur Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung, wo steht da die Don-Bosco-Schule?
JH-vdW: Das habe ich bei der Vorstellung der Schule vergessen: Wir sind keine inklusive Schule, sondern als Förderschule eine sehr exklusive Schule. Ich nutze gern diesen Begriff. Unser Hauptziel ist die größtmögliche Teilhabe. Das ist unser Beitrag im Hinblick auf Inklusion. Um diese zu erreichen habe wir ein exklusives Förderangebot, das auch, zumindest noch – so erlebe ich es – für viele Schüler noch ganz wichtig ist, um dann auch später möglichst teilhaben zu können, z. B. im Berufsleben. Das gilt aber auch für alle anderen Lebensbereich. So funktionieren ja Schulen oder Ausbildungsinstitute allgemein, dass man im speziellen Rahmen vorbereitet wird auf einen größeren Rahmen. Das wäre sicherlich noch anders denkbar, aber noch ist das sehr wertvoll, weil auch unsere Schüler schon ein anderes ganzzeitliches Angebot brauchen, um dann zu den Leistungen oder Arbeitsmöglichkeiten zu kommen, um sich die Welt zu erschließen, die sie sich gerne wünschen.
Ähnliches gibt es in anderen Bereichen, z. B. in der Medizin. Wir haben in Rheinland-Pfalz sowie allen Bundesländern die sozialpädiatrischen Zentren für Kinder mit Behinderungen. Es gibt jetzt immer mehr medizinische Erwachsenen-Zentren für Menschen mit Behinderung, weil auch sie ein anderes Angebot brauchen, als das einer durchschnittlichen Kinderarztpraxis oder Hausarztpraxis. So verhält es sich auch mit der Schule. Durch diese Exklusivität versuchen wir dann später eine größtmögliche Teilhabe und Inklusivität zu erreichen.
CD: Also erreichen Sie durch die Exklusivität eine größtmögliche Teilhabe. Wie bewerten Sie denn in diesem Kontext die Fördermöglichkeiten, die es für Arbeitgeber gibt, um Menschen mit Behinderung einzustellen? Halten sie das eher für gut ausgebaut, für verbesserungswürdig oder sehen Sie es kritisch, da der exklusive Charakter eher erhalten bleibt?
JH-vdW: Es gibt sehr viele Förderungsmöglichkeiten für Arbeitgeber. Ein großes Problem ist die zeitliche Begrenzung von meist 2 Jahren. Da steckte eine Denkweise dahinter, die uns im Bereich Schule Inklusion trifft. Es ist immer noch in den Köpfen verankert, das sind Schüler oder später auch Mitarbeitende, die einfach etwas länger brauchen. Wenn ich z. B. anstatt 3 Jahren Lehrzeit 4 Jahre benötige oder in der Schule mehr Zeit brauche, dann werden Menschen mit Behinderung genauso im Berufsleben länger brauchen. Dabei brauchen sie in der Schule wie auch in der Lehrzeit einfach nur andere Formen der Ansprache, der Förderung und der Begleitung. Diese Denkweise ist noch nicht angekommen, weder im Schul- noch im Arbeitsbereich sind viele Dinge auf 2 Jahre begrenzt. Dass ein Arbeitgeber 2 Jahre lang Fördermöglichkeiten hat, die dann aber irgendwann auslaufen, basiert auf der Idee: Dann soll der Mensch mit Behinderung genau so leistungsfähig, sprich produktiv und erfolgreich sein, wie ein Arbeitnehmer ohne Behinderung. Wir leben ja in eigentlich nicht in einer Leistungsgesellschaft, sondern in einer Erfolgsgesellschaft. Alle unsere Schüler*Innen, die später in der Werkstatt arbeiten, leisten jeden Tag Immenses. Teilweise mehr als ich, als Schulleiter, aber werden bei weitem nicht so entlohnt, denn wir sind nicht in einer Leistungs- sondern einer Erfolgsgesellschaft. Auch in der Schule ist das so. Wenn ein Schuler sich von einer 6 auf eine 5 hocharbeitet, mit einer Anstrengung und Intensität und Tränen und Übung, dann ist das trotzdem nur eine 5. Ein anderer, der nicht lernen muss für eine 1, hat aber die 1. Das ist das was leider zählt.
CD: Ihr großer Kritikpunkt ist also der zeitliche Korridor, der wesentlich zu kurz angesetzt ist, damit dem eigentlichen Ansinnen und vor allen Dingen dem Menschen nicht gerecht wird.
JH-vdW: Es gibt allerdings auch sehr gute Programme, wo ein Umdenken stattgefunden hat. Früher ist man immer von einer Ausbildung ausgegangen, hat dann aber gesagt, gut, den Ausbildungsgang können nicht alle bestehen. Dann folgten Teilausbildungen, wie z. B. den Hilfskoch. Es gibt Möglichkeiten, sich auch in diesen „Hilfs“-Bereichen zu spezialisieren, also „Training on the job“, im Berufsleben. Damit sind die Berufsbezeichnungen nicht mehr so eng speziell für eine Tätigkeit. Das kommt natürlich wiederum dem Schüler*In oder Mitarbeiter*In sehr entgegen, weil die Talente sehr verschieden sind und eventuell einzelne Bereiche eines Ausbildungsberufes ganz toll erfüllt und erlernt werden können.
CD: Das heißt, eigentlich müsste man eher den Aspekt „Training on the job“ fokussieren, um eine leichtere Möglichkeit zu haben, um in den 1. Arbeitsmarkt einzutreten?
JH-vdW: Genau, und zwar, immer von der Person ausgehend. So wie wir von der Schule arbeiten. Wir gucken uns den Schüler an und überlegen mit ihm, was kann er lernen und was nicht. In der Arbeitswelt wäre es genauso. Es gibt nicht die Norm, wo die Abschlussprüfung Koch dahinter ist, sondern, was kann der Schüler Tolles leisten, wo kann er eingesetzt werden und so in den Beruf überzugehen. Perspektive sollte der Mensch sein und nicht eine Norm.
CD: Es ist natürlich ziemlich schwierig, wenn man sich die ganzen Berufsverordnungen anschaut, die es zu erfüllen gibt – da sind wir wieder bei dem administrativen regulatorischen Teil, das dann wirklich so umzusetzen, dass „Training on the job“ auch wirklich gut gelingen kann.
JH-vdW: Ja, aber die Möglichkeiten gibt es und da ist auch schon viel gelungen auchim Hinblick auf Inklusion. Neben den Werkstätten für Menschen mit Behinderung, gibt es die sogenannte „unterstützte Beschäftigung“:
Unterstützte Beschäftigung ist ein Modell, bei dem ein Bildungsträger für einen Berufsweg 2 Jahre Zeit hat einen Mitarbeitenden sehr intensiv zu begleiten, also „Training on the job“.
Es gibt aber auch Modelle, wo das Ganze noch unter dem Dach der Werkstatt funktioniert und so weichere Übergänge ermöglicht werden. Das ist natürlich sehr geschickt. So haben wir viele Schüler, die zunächst auch mal in der Werkstatt angefangen haben, dann auf sogenannten „Außenarbeitsplätzen“ eingesetzt waren, in ganz normalen Betrieben, wie z B. in einem großen Supermarkt, im Gärtnereibetrieb aber noch unter dem Dach der Werkstatt und damit mit dem Auffangmechanismus. Die Kollegin bei der Arbeitsagentur nennt das immer das Auffangnetz oder den doppelten Boden. Wenn das gut funktioniert, können die Personen ganz auf den 1. Arbeitsmarkt wechseln, aber sie sind zunächst in diesem Zwischenschritt unter dem Dach der Werkstatt mit allen Nachteilen, sprich mit den Verdienstmöglichkeiten, die sehr gering sind, aber auch allen Vorteilen, dass da noch ein Auffangmechanismus ist.
Also da hat sich sehr viel getan und da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten.
CD: Wenn sie von Ihrer Erfahrung heraus einmal Rückschau halten: Welche Berufe werden hauptsächlich angestrebt oder ergriffen und wie ist die prozentuale Gewichtung mit dem Einstieg auf den 1. Arbeitsmarkt?
JH-vdW: Die Berufe sind sehr unterschiedlich. Immer mit einer praktischen Tätigkeit und weniger eine Bürotätigkeit. Wo es einen großen Unterschied gibt, ist der Geschlechtsunterschied. Es ist immer noch so, dass es einfach mehr Berufsmöglichkeiten für junge Männer gibt als für junge Frauen. Für praktische Tätigkeiten sind eben Muskelkraft und Ähnliches gefordert. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten für beide Geschlechter, sei es irgendwo an der Pforte oder Kuriermöglichkeiten, in Großküchen, in Wäschereien, im Grünbereich, im Gartenbereich, in der Landschaftspflege, sehr verschieden.
Jetzt haben wir aktuell gerade eine Schülerin im Frisörbereich, die da schon lange ein Praktikum macht und nur noch einen Tag in die Schule kommt. Solche Modelle können wir ebenfalls anbieten. Also ich weiß gar nicht, was wir noch alles haben, aber das ist sehr unterschiedlich. Landwirtschaft im weitesten Sinne, Weinbau, Gartenbau.
Prozentual ist es immer noch so, dass nahezu 90% unserer Schüler*Innen im weitesten Sinne im Bereich einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten und nur ganz wenige den Schritt in den 1. Arbeitsmarkt wagen. Das hängt aber auch oft mit den Unterstützungsmöglichkeiten, wie Arbeitsassistenz usw. zusammen. Aber das ist ähnlich auch wie bei der Schulwahl. Das entscheidende Kriterium ist da oft, wie bin ich sozial eingebunden und wie sind die sozialen Erlebnisse.
Also, wenn ich auf dem 1. Arbeitsmarkt mit einem Arbeitsassistenten arbeite, dann habe ich nur mit dem Assistenten zu tun und kann mich nur schwer in das Team integrieren. In der Werkstatt ist es ganz wichtig für unsere Schüler*Innen, dass sie viele Freundschaften schließen, soziale Kontakte haben. Beim Mittagessen sitzt man gemeinsam in der Cafeteria, man hat noch zusätzliche Anknüpfungspunkte, Freizeitmöglichkeiten und dass das letztendlich zur Entscheidung führt im geschützten Bereich zu bleiben.
Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe im Arbeitsmarkt bedeutet auch zu erfahren, wie wertvoll Menschen mit Behinderung für ihr eigenes Leben, für das gesellschaftliche Leben sind und deswegen es eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass sie überall, auch im Betrieb, arbeiten.
Noch ist das sicherlich keine Selbstverständlichkeit bei uns in der Gesellschaft. Es gibt viele Berührungsängste usw. und der Wert wird häufig nicht so gesehen, das hängt auch mit diesem Leistungs- oder Erfolgsgedanken zusammen. Deswegen wiederum wählen sehr viele Schüler*Innen für ihr Arbeitsleben dann auch die Werkstatt. Genauso wie die Eltern die Entscheidung für diese „exklusive Schule“, für die Förderschule treffen. Dabei können die Eltern Ihre Kinder auch auf eine Schwerpunkt-Schule / Inklusions-Schule anmelden. Dort werden die Schüler*Innen mit einem ganzzeitlichem Förderbedarf die ganze Zeit von einem Integrationshelfer betreut. Genau das ist der Punkt, bei dem die Eltern sagen „ja Moment mal“. Der große Vorteil: Es ist immer ein erwachsener Mensch da, der helfen kann, das ist aber auch genau der Hauptnachteil. Der Schüler soll auch von den Schülern viel lernen und mit den Schülern zusammen lernen und dabei ist der Integrationshelfer quasi der Störfaktor.
Es gibt aber auch da ganz tolle Ausnahmen, wo Schüler*Innen in einem Betrieb auch toll aufgenommen werden. Das hängt aber auch oft mit persönlichen Kontakten zusammen, wenn der Schüler in einem Dorf groß geworden ist und man sich kennt, z. B. vom Fußballplatz. Dann kennt ihn jeder im Betrieb, was weitaus leichter ist als in einem großen Werksbetrieb, der sehr anonym abläuft, vielleicht auch nur mit Akkordarbeit usw.
CD: Das heißt, neben diesem Exklusiven, bedarf es einer großen Portion Mut. Mut, sowohl von Menschen mit Behinderung, auf sich aufmerksam zu machen und zu sagen „Hey wir können auch was, wir brauchen vielleicht 1-2 Minuten länger, aber wir können das genauso gut, wie alle andere auch“, um dieses Exklusive etwas aufzuweichen. Das heißt, eher auch mutig zu sein, nach außen zu treten und sich auch der ein oder anderen Herausforderungen zu stellen. Aber auch seitens der Arbeitgeber, mutig und offen zu sein, Flexibilität an den Tag zu legen und mehr „Training on the job“ durchzuführen, als die Berufsverordnungen 100% erfüllen zu müssen oder zu können?
JH-vdW: Ja, also gerade beim Arbeitgeber oder da bei allen Beschäftigten in einer Firma, da will ich den Mut sehen. Denn wenn ich unsere Schüler*Innen betrachte, die bringen sehr viel Mut mit, stellen sich auf neue Situationen ein, gehen auf Menschen zu. Sie sind aber natürlich dann auf eine Erwiderung angewiesen. Als Schulleiter sage ich bei Diskussionen mit meinem Kollegium oft, dass eigentlich unsere Schüler*Innen, das erleben wir immer wieder, viel flexibler und mutiger sind als wir Lehrkräfte, das ist schon interessant. Also am Mut liegt es nicht. Natürlich bedarf es einer höheren Frustrationstoleranz und Akzeptanz, aber da arbeiten wir intensiv daran, denn das kann natürlich auch ein Betrieb nicht allein stemmen. Das muss in das gesellschaftliche Umdenken nach und nach hineinkommen und nicht zuletzt deswegen haben wir einen europäischen Protesttag, damit sich das auch nochmal in der Bevölkerung stärker verankert und dann machen es die ganz persönlichen Erfahrungen.
CD: Vielen Dank! Das war auch schon ein sehr gutes Schluss-Statement. Vielen Dank für Ihre Zeit!